Tak to widzą Niemcy - rozliczenie z przeszłością w Rodzinie Martina Schulza
miłość rok 1940
"Im Laufe unseres Lebens haben wir alle viele Hochzeitsfotos gesehen. Auf diesen Fotos erblickt man in den Augen des Brautpaars das Leuchten der Verliebten, diese hoffnungsvolle Erwartung auf ein neues, auf ein besseres Leben. Deshalb berühren uns Hochzeitsfotos so stark, weil sie in die Zukunft weisen. Das Foto meiner Eltern ist eher gedämpft. Denn in ihren Augen sieht man Skepsis. Ihre Mienen wollen nicht recht zu dem festlichen Anlass und dem feierlichen Rahmen passen. Sie ganz in Weiß und er in Uniform. Der Grund hierfür: Meine Eltern haben am 30.April 1940 geheiratet, nur wenige Tage später, Anfang Mai 1940, wurde mein Vater eingezogen."
Refleksyjnie, romantycznie, żadnego odniesienia do już popełnionych przez Niemców zbrodni.
Panna młoda na biało, pan młody w mundurze - pięknie !
"SLOWIKI WE LWOWIE"
Lwów w rękach nazistów
ROK 1941
http://oper-1974.livejournal.com/345600.html

NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN
Na Zachodzie bez zmian cz.1/9 - YouTube
Na zachodzie bez zmian - Erich Maria Remarque - Merlin.pl
Kwiecień 2010 - Powieść Na Zachodzie bez zmian należy do najgłośniejszych dzieł literatury XX wieku. Jej bohaterowie, podobnie jak sam autor, należą do ...
gatunek: Dramat, Wojenny
premiera: 14 listopada 1979 (świat)
produkcja: USA, Wielka Brytania
reżyseria: Delbert Mann
scenariusz:Paul Monash
Remake pierwszej ekranizacji pacyfistycznej powieści Ericha Marii Remarkque'a, nakręconej w 1930 roku przez Lewisa Milestone'a. Film opowiada o przeżyciach grupy młodych Niemców wysłanych na bezsensowną wojnę imperialistyczną - I wojnę światową. Dla wielu z nich będzie to gorzki czas szybkiego wchodzenia w dorosłość.
MIMO TEGO W ROKU 1939 SAMI TEGO CHCIELI ONI NIEMCY: "NASI OJCOWIE, NASZE MATKI" SZYKUJĄC GEHENNĘ DLA INNYCH NARODÓW SŁOWIAN, ROMÓW A SZCZEGÓLNIE NARODU ŻYDOWSKIEGO JAKUBA, IZAAKA, DAWIDA. Tego NARODU z jego WIARĄ I ponad 2000 letnią HISTORIĄ WIARY W JEDYNEGO BOGA NIEBA I ZMIEMI.


Jean-Claude Juncker
EURO menace Jean-Claude Juncker’s dad fought for Hitler in World War Two.
And his father-in-law was a Nazi sympathiser who persecuted Jews in his home country.
Juncker, 59, is tipped to be the European Commission’s new president.
But his plans for a bigger EU with less say for the UK have led to opposition from David Cameron — and The Sun branding him the most dangerous man in Europe.
Sources say the ex-Luxembourg PM’s demands stem from shame over his dad.
Steel worker Joseph was forced to join the German army and fight in Russia from 1941. Juncker’s EU colleague Henri Grethen said: “The experience of his father had a big impact. He doesn’t want the story repeated.”
Father-in-law Louis Mathias Frising — dad to Juncker’s wife of 35 years Christiane — was a teacher in Ettelbruck, Luxembourg, when the Germans invaded in 1940.
Frising volunteered to be a Nazi propaganda chief while banning spoken French in favour of German.
He was also responsible for enforcing a law which stripped Jews of their rights and professions — the first stage of the Holocaust.
After the war Frising had his teaching licence revoked and set up a DIY shop. He had two daughters before dying aged 89 in 2004.
A neighbour said: “I knew Louis for 30 years and had no idea he was a Nazi sympathiser. He kept that quiet because presumably it would have been politically damaging to Jean-Claude.”
The Junckers live in a £2million mansion near Luxembourg City. His campaign manager declined to comment.
Czytam to i owo...: Tylko wojna. "Na zachodzie bez zmian ...
Feb 25, 2015 - A "Na zachodzie bez zmian" Ericha Marii Remarque'a jest nie tylko najsłynniejszą powieścią o I wojnie światowej, ale też jedną z ...
A W POLSCE ?


w Warszawie

„Unsere Mütter, unsere Väter“ im ZDFDie Geschichte deutscher Albträume
Warten Sie nicht auf einen hohen Feiertag, versammeln Sie jetzt Ihre Familie: Der ZDF-Dreiteiler „Unsere Mütter, unsere Väter“ beginnt am Sonntag und ist die letzte Chance, über die Generationen hinweg die Geschichte des Krieges zu erzählen.
15.03.2013, von FRANK SCHIRRMACHERMan braucht sechs Augenpaare, um diesen Film zu sehen. Sechs Augenpaare, die nichts anderes wären als die Blicke dreier Generationen: Großeltern, Eltern, Kinder. Sie müssen gemeinsam sehen, was auf dem Bildschirm geschieht. Dann wird man vielleicht die Erfahrung machen, wie es ist, wenn Tote ins Leben zurückkehren.
Deshalb der unerbetene Rat an die Leser: Trommeln Sie am Sonntag die Familie zusammen und sehen Sie fern. Wo immer möglich, sollten Eltern den ZDF-Dreiteiler „Unsere Mütter, unsere Väter“ zusammen, mit ihren Kindern ansehen (freigegeben, trotz einiger sehr grausamer Szenen, ab 12 Jahren). Und dort, wo es die Familiendemographie erlaubt, zusammen mit den Kindern der Kinder. Warum sich solche Verabredungen für Silvester aufsparen? Es tickt eine ganz andere Uhr: In Europa geht gerade die Zeitgenossenschaft des Zweiten Weltkrieges zu Ende. Die Minuten und Sekunden verrinnen; bald ist keiner mehr da, der noch dabei war.
Die Geschichten, die bis Mitternacht nicht erzählt sind, werden nie mehr erzählt werden. Fragen, die einem viel zu spät einfallen, wenn niemand mehr da ist, sie zu beantworten. Wir befinden uns, was das kollektive Gedächtnis angeht, eine Minute vor Mitternacht. Nicht mehr lange, und alles wird nur noch Fotografie, Film oder Buch sein. Und ausgerechnet ein ZDF-Film soll da eine letzte Chance sein, die Uhr anzuhalten und zumindest eine Stunde dazuzugewinnen? Ja, das ist so. Die Reaktionen derjenigen, die ihn bisher gesehen haben, sprechen dafür.
Die Frage war: Was habt ihr nicht erzählen können?
„Opa erzählt wieder vom Krieg“: Das war immer eine Wilhelm-Busch-Version der wirklichen Verhältnisse, eher 1871 als 1945. Die Frage war immer eine ganz andere: Was war es, was ihr nicht habt erzählen können? Die Antwort darauf war nicht nur moralisch prekär. Sie war es auch grammatikalisch. Sätze brauchen ein Subjekt, Erzählungen brauchen Identifikationsfiguren. Was aber, wenn da nichts zum Identifizieren ist?
Die Deutschen haben mühsame Aus- und Umwege gesucht, um das Problem zu lösen. Sie haben Kinderfiguren in den Mittelpunkt ihrer Nachkriegsidentifikation gestellt, einen, der nicht mehr wächst und auch als Erwachsener Kind bleibt wie Oskar Matzerath, oder den Schulaufsatz in Siegfried Lenz’ „Deutschstunde“, um nur die einflussreichsten Ich-Erzählungen zu nennen.
Lange Zeit wurde die Darstellung des erwachsenen Subjekts im Krieg an Klischee-Fabriken eines Konsalik ausgelagert, bis dann die Kinder von einst selbst Erwachsene, Eltern und schließlich Großeltern geworden waren. Da stehen wir heute. Und nun kommt ein ZDF-Dreiteiler und riskiert nichts weniger, als die Geschichte noch einmal neu zu erzählen. In der Tat: mit sehr jungen Menschen, alle zwischen 20 und 25 Jahre alt, als Protagonisten. Aber es sind junge Menschen, die unterdessen zu Eltern, Großeltern oder sogar Urgroßeltern geworden sind. Von dieser Verbindung in unsere Jetzt-Welt ist dieser Film nicht zu lösen.
 © DAVID SLAMA/ZDF
© DAVID SLAMA/ZDF![]() Das sind die fünf Freunde, die sich an Silvester 1940 in Berlin treffen und sich versprechen, bis Weihnachten 1941 siegreich wieder zu Hause zu sein: Charlotte (Miriam Stein, links), Wilhelm (Volker Bruch), Greta (Katharina Schüttler), Friedhelm (Tom Schilling) und Viktor (Ludwig Trepte)
Das sind die fünf Freunde, die sich an Silvester 1940 in Berlin treffen und sich versprechen, bis Weihnachten 1941 siegreich wieder zu Hause zu sein: Charlotte (Miriam Stein, links), Wilhelm (Volker Bruch), Greta (Katharina Schüttler), Friedhelm (Tom Schilling) und Viktor (Ludwig Trepte)
Man wacht in einem Albtraum auf. Und wer noch Kontakt zu den letzten Überlebenden jener Generation hat, der weiß, dass das keine feuilletonistische Metapher ist. Am Tage funktionierten alle perfekt, schon fast unmittelbar nach Kriegsende, und die letzten Szenen des Films geben davon eine gute Vorstellung. Vielleicht also müsste man sich den Nächten zuwenden. Man müsste eine Geschichte schreiben, wer alles in den Jahrzehnten dieser erfolgsverwöhnten Bundesrepublik nachts in Albträumen aufwachte und wer einen ruhigen Schlaf hatte.
Der Film will es wissen: jetzt
Diese auffällige, fast manische Beschäftigung mit Träumen etwa in den „Spandauer Tagebüchern“ des Albert Speer, die immer wirken wie Geschichten, die man erzählen müsste und die mitten im Satz steckenbleiben, bis schließlich der ganze Mensch nur noch ein angefangener, steckengebliebener Satz ist, der nie ausspricht, was er sagen wollte.
„Unsere Mütter, unsere Väter“ im ZDFDie Geschichte deutscher Albträume
Das ist das Stichwort dieses Films. Er will es jetzt wissen. Er will den Satz zu Ende sprechen. Verständlich, dass es da Befürchtungen gibt. Doch ehe man abwinkt, wie es jetzt manche tun, weil man es „nicht mehr hören kann“, oder andere, durchaus zu Recht, die „Hitler sells“ rufen: Nichts dergleichen liegt hier vor.
Fünf Freunde, die sich 1941 in Berlin treffen, darunter ein Jude, und die unsere Eltern oder Großeltern sein könnten, junge, sympathische Leute, ein wirklicher Nazi ist nicht unter ihnen. Und nun zeigt der Film, wie sich in nur vier Jahren Charakter, Person, Moral und Land fundamental verändern. „Verändern“ ist hier nur ein anderes Wort für den Prozess einer vollständigen Vernichtung.
Als Zuschauer befindet man sich bei den drei Teilen dieses Films in einer ständigen Suchbewegung: Immer will man sein „Vertrauen“ an einer Figur festmachen, sich mit ihr identifizieren und - das Wort ist keinesfalls zu pathetisch - eine Art von moralischer und sozialer Geborgenheit in einer intakten Persönlichkeit finden. Es ist genau das, was den Titel „Unsere Mütter, unsere Väter“ so überaus plausibel macht: Die Ursehnsucht nach demjenigen oder derjenigen, die einen nicht im Stich lassen. Aber die Sehnsucht, die der Film am Anfang befördert, entzieht er mit jeder Minute.
Die barbarische Kälte der Welt
Da ist, von Viktor, dem verfolgten Juden, abgesehen, niemand, der nicht an dem Prozess der moralischen Selbstzerstörung beteiligt wäre. Das ist, jenseits einiger Szenen, das Grausame dieses Werks: Es reproduziert die barbarische Kälte der Welt, die es beschreibt, indem es den Zuschauer in Illusionen wiegt, die es sogleich selbst zerstört. Eine umfängliche Literatur hat immer wieder die Charakteristika der Täter durchleuchtet, von den Einsatzgruppen bis zum politischen Personal des Dritten Reichs.
Was aber viel schwerer zu verstehen ist, das ist eine Figur, die als junge Krankenschwester sogar russischen Kriegsgefangenen beisteht und dennoch, in einem nachgerade unfassbar routinierten Prozess, die jüdische Mit-Krankenschwester denunziert. Eine Figur, die die Entmenschlichung des Krieges durchschaut, sich den Parolen entzieht und dennoch auf die Idee kommt, Kriegsgefangene zum selbstmörderischen Aufspüren von Minen einzusetzen.
Unmöglich, alle Details dieses Films zu beschreiben. Selten zuvor beispielsweise hat man so sehr verstanden, wie die Indoktrinationsmaschine des Nationalsozialismus funktionierte. Und eigentlich noch nie hat man so klar sehen können, dass auch die Feinde der Nazis nicht die Freunde ihrer Opfer sein mussten. Die - authentische - Geschichte des Juden Viktor, der unter Partisanen gerät, die aus ihrem Antisemitismus keinen Hehl machen, gehört zu den berührendsten Momenten dieses Films. Er zeigt, anders, als es unsere Hollywood-Phantasie uns einredet, dass die Opfer in Wahrheit vollständig allein und einsam waren: eine in humanistischer Empörung vereinte zivilisatorische Gegenwelt, wie sie Thomas Mann in seinen Radioansprachen beschworen hat, war in Wahrheit wie die Zivilisation eines anderen Planeten.
Eine neue Phase der Aufarbeitung
Dieser Film, den Nico Hofmann produziert und dessen vorzügliches Drehbuch Stefan Kolditz geschrieben hat, besitzt in seiner unbestreitbaren Wucht und Monstrosität die Chance, den letzten Zeitgenossen noch einmal inmitten ihrer Familie die Zunge zu lösen. Er leitet, das haben Vorabkritiken mit Recht hervorgehoben, eine neue Phase der filmisch-historischen Aufarbeitung des Nationalsozialismus ein.
 © DAVID SLAMA/ZDF
© DAVID SLAMA/ZDF![]() Schwer zu verstehen: Die Krankenschwester Greta (Katharina Schüttler) - hier zusammen mit ihrer Freundin Charlotte (Miriam Stein) - steht sogar russischen Kriegsgefangenen bei, denunziert aber eine jüdische Mit-Krankenschwester
Schwer zu verstehen: Die Krankenschwester Greta (Katharina Schüttler) - hier zusammen mit ihrer Freundin Charlotte (Miriam Stein) - steht sogar russischen Kriegsgefangenen bei, denunziert aber eine jüdische Mit-Krankenschwester
Nico Hofmann, den mancher gerne für unernst hält, weil er auch unernste Stoffe produziert, ist selbst der Protagonist dieser neuen Phase. Er, Jahrgang 1959, der nun endgültig zu den ganz großen Produzenten des Landes gezählt werden muss, redet auch von seiner eigenen Mutter und seinem eigenen Vater, und man geht nicht zu weit, wenn man behauptet, dass er die siebenjährige Arbeit an diesem Film auch deshalb auf sich nahm, um mit seinen Eltern ein letztes Mal ins Gespräch zu kommen.
„Unsere Mütter, unsere Väter“ im ZDFDie Geschichte deutscher Albträume
Die Ernsthaftigkeit, die Detailtreue, die Kompromisslosigkeit, mit denen er es tat, sind bewundernswert und haben das Zeug dazu, die Seele des Landes anzurühren. Wer wäre man selbst in diesem Film gewesen? Wer wäre man geworden, wenn man 1941 zwanzig Jahre alt gewesen wäre? Das sind die zukunftsweisenden und am Ende unabweisbaren Fragen, die Nico Hofmanns großes Werk im Zuschauer zurücklässt.
Eine Ahnung von der Brutalität der Wahrheit
Und wenn wir schon bei unerbetenen Ratschlägen sind: Ein weiterer, ungleich profanerer wäre, bei der populären Gebührendebatte und der Diskussion über die Zukunft öffentlich-rechtlicher Systeme pragmatischer zu argumentieren. Dass das ZDF unter dem Intendanten Bellut das Risiko dieses Films einging - allein die Brutalität wird Debatten hervorrufen, wenn man vergisst, dass die Brutalität des Films nur eine Ahnung der Brutalität der Wahrheit ist -, verdient nicht nur großen Respekt. Es zeigt, was öffentlich-rechtliches Fernsehen vermag und wozu es da ist - und umgekehrt, wozu wir da wären: den Beteiligten den Mut zu machen, dass sich solche Risiken lohnen können.
- Kriegserinnerungen: „Du wolltest ja leben“
- Leserdebatte zu „Unsere Mütter, unsere Väter“: Die F.A.Z. bittet um Ihre Texte und Fotos
- Das ZDF dreht einen gigantischen Historienfilm: Als liefen sie tatsächlich um ihr Leben
Ein Land, das sich über einem neuen „Tatort“ mit Til Schweiger spaltet und darüber tagelang öffentlich diskutiert, wird, so ist zu hoffen, die Chance, ja, das Geschenk einer Selbsterkundung, die dieser Dreiteiler darstellt, annehmen. Es wird vielleicht weniger laut und auch nicht in digitaler Echtzeit geschehen; es wird hoffentlich in den Familien und mit Freunden diskutiert, vielleicht auch nur so wie in der Redaktion dieser Zeitung geschehen, dass sehr junge Leute ihre Eltern nach den längst verstorbenen Großeltern fragen.
Familiengeschichten sind Produktionsstätten von Identitäten; man lernt vom Scheitern und Versagen mehr als von den Erfolgsgeschichten der Wirtschaftswundergeneration. In einem Europa, das jetzt zu vergessen beginnt, was es einst war, sind solche Familiengeschichten auch der Kern der europäischen Idee - und sei es nur, dass man begreift: Das alles liegt erst eine Generation zurück.
Wir haben die Chance zu begreifen
Man schaue diesen Film. Man kritisiere ihn (oder den Rezensenten), man tadele, seine Ausführung, die (großartigen und völlig unverbrauchten) Schauspieler, aber man schaue ihn wenigstens an. Es ist nicht nur ein Film, es ist eine soziale Plattform. Man muss zumindest eine Ahnung davon haben, welche Träume in den Nächten dieser reichen Republik geträumt wurden, welche Schuld verarbeitet oder ignoriert wurde und wie sie das verwandelten, was wir am hellen Tag erlebten: die Generation der Politiker, die noch wusste, was ein Krieg war, und all der anderen, die wussten nicht nur, wozu Menschen, sondern auch, wozu sie selbst fähig waren.
 © DAVID SLAMA/ZDF
© DAVID SLAMA/ZDF![]() Sein Weg führt von der Überzeugung zur Desertion: Wilhelm Winter (Volker Bruch)
Sein Weg führt von der Überzeugung zur Desertion: Wilhelm Winter (Volker Bruch)
Dieses Bewusstsein schwindet, und dieser Film hält es wach. In ihrem Werk „Das Leiden anderer betrachten“ hatte Susan Sontag geschrieben: „Die Toten interessieren sich nicht im geringsten für die Lebenden. Wir begreifen nicht. Wir können uns einfach nicht vorstellen, wie das war. Wir können uns nicht vorstellen, wie furchtbar, wie erschreckend der Krieg ist; und wie normal er wird. Können es nicht verstehen und können es uns nicht vorstellen.“
Das ist aus der Perspektive der Toten gesprochen. Aber solange es noch Lebende gibt, haben wir die Chance zu begreifen. „Kommt, reden wir zusammen, wer redet, ist nicht tot“, lautet die berühmte Zeile von Gottfried Benn. Nico Hofmann und das ZDF geben uns dazu jetzt die Chance.
„Unsere Mütter, unsere Väter“ läuft in drei Teilen am Sonntag, 17. März, am Montag, 18. März, und am Mittwoch, 20. März, jeweils um 20.15 Uhr im ZDF.
Quelle: F.A.Z.

Są to pięciu przyjaciół, którzy spotykają się na Sylwestra 1940 roku w Berlinie i obiecują sobie, że zwycięsko aż do Bożego Narodzenia 1941 roku do domu: Charlotte (Miriam Stein, po lewej), Wilhelm (Volker Bruch), Greta (Katharina Schüttler), Friedhelm ( Tom Schilling) i Wiktor (Ludwig Trepte)
Martin Schulz zu „Unsere Mütter, unsere Väter“Was die Geschichte dieses Films uns lehrt
„Der Krieg wird das Schlechteste in uns zum Vorschein bringen“: Das ist der zentrale Satz des Films „Unsere Mütter, unsere Väter“. Europa hat daraus Lehren gezogen. Doch die Demokratie muss jeden Tag neu erkämpft werden.
19.03.2013, von MARTIN SCHULZIrgendetwas am Hochzeitsfoto meiner Eltern ist anders. Auf dem Bild zu sehen sind meine Mutter und mein Vater, kurz nachdem sie sich das Jawort gegeben haben. Es sind zwei Menschen, die sich füreinander entschieden haben und die ihren Weg von nun an gemeinsam gehen wollen. Und doch irritiert das Foto den Betrachter.
Im Laufe unseres Lebens haben wir alle viele Hochzeitsfotos gesehen. Auf diesen Fotos erblickt man in den Augen des Brautpaars das Leuchten der Verliebten, diese hoffnungsvolle Erwartung auf ein neues, auf ein besseres Leben. Deshalb berühren uns Hochzeitsfotos so stark, weil sie in die Zukunft weisen. Das Foto meiner Eltern ist eher gedämpft. Denn in ihren Augen sieht man Skepsis. Ihre Mienen wollen nicht recht zu dem festlichen Anlass und dem feierlichen Rahmen passen. Sie ganz in Weiß und er in Uniform. Der Grund hierfür: Meine Eltern haben am 30.April 1940 geheiratet, nur wenige Tage später, Anfang Mai 1940, wurde mein Vater eingezogen.
Er wurde Soldat im Zweiten Weltkrieg, inmitten dieses Weltenbrands. Inmitten dieses furchtbaren Krieges, mit dem die Deutschen die Welt überzogen und der mit Auschwitz den Tiefpunkt der menschlichen Zivilisation markiert. Damit wurde mein Vater, wie fast alle Männer seiner Generation, ein kleines Rädchen in der Tötungsmaschinerie, mit der auch die Wehrmacht den barbarischen Rassenwahn der Nationalsozialisten umsetzte.
 © DAVID SLAMA
© DAVID SLAMA![]() Rädchen in der Vernichtungsmaschinerie: Filmszene aus den Schützengräben des Weltkriegs
Rädchen in der Vernichtungsmaschinerie: Filmszene aus den Schützengräben des Weltkriegs
„Der Krieg wird das Schlechteste in uns zum Vorschein bringen“, sagt in dem Fernsehdreiteiler „Unsere Mütter, unsere Väter“ Friedhelm zu seinem großen Bruder, ehe sie gemeinsam als Wehrmachtssoldaten in den Krieg ziehen. Dieser Satz ist der Kernsatz in diesem bedrückenden Film, der mich aufgewühlt, ja, der mich verstört hat. Er zeigt die Geschichte fünf junger Menschen, die alle das Beste wollen. Junge Menschen, die Ideale haben, die aber alle im und durch den Krieg verändert werden.
Da ist der smarte Kriegsheld Wilhelm, der so fest glaubt an ein altes, soldatisches Ideal, das es so nie gegeben hat. Er wird zum Mörder, als er, dem furchtbaren Kommissarsbefehl folgend, einen Kriegsgefangenen erschießt und wissentlich das schon damals gültige humanitäre Völkerrecht bricht. Wilhelm funktioniert, weil er Befehlen folgt. Er befolgt sie, obschon er weiß, dass sein Handeln falsch, ja verbrecherisch ist. Da ist sein jüngerer Bruder Friedhelm, ein sensibler Schöngeist, der in sein spärliches Marschgepäck noch Bücher einpackt, auf die er auch an der Front nicht verzichten will. Er versucht sich lange der Kriegslogik zu entziehen, aber auch er mutiert schließlich zur perfekten Tötungsmaschine.
Da ist die karriereorientierte Greta, die ein Star werden will und von den Bühnen in Wien und Paris träumt. Sie geht einen Pakt mit dem Teufel ein, beginnt eine Affäre mit einem SS-Sturmbannführer. Zunächst um ihren jüdischen Freund Viktor zu retten, aber immer mehr, um als Sängerin zu Ruhm zu kommen. Sie verschließt die Augen vor dem Offensichtlichen, weil sie das schöne Leben in einer Welt will, in der man das schöne Leben nicht mehr erreichen kann, ohne dass man selbst Schuld auf sich lädt. Da ist Charlotte, die sich vor Liebe für Wilhelm verzehrt, sich aber nicht traut, ihm ihre Gefühle zu offenbaren. Weil auch sie etwas beitragen will, meldet sie sich freiwillig zum Dienst als Frontschwester. In erschreckender Naivität betet sie dort die dumpfe Nazi-Propaganda nach, und in ihrem Bestreben, alles richtig zu machen, verrät sie eine jüdische Ärztin, die ihr eine Freundin hätte werden können.
 © DAVID SLAMA
© DAVID SLAMA![]() Vom Karrierewunsch zum Pakt mit dem Teufel verführt: Katharina Schüttler als Greta in „Unsere Mütter, unsere Väter“
Vom Karrierewunsch zum Pakt mit dem Teufel verführt: Katharina Schüttler als Greta in „Unsere Mütter, unsere Väter“
Mit Ausnahme von Viktor - der sich dem bewaffneten polnischen Widerstand anschließt und der schon vorher gegen seinen Vater aufbegehrt, weil dieser viel zu lange glaubt, er würde von der Judenverfolgung verschont, weil er im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft hatte - werden alle in diesem Freundeskreis auf fatale Weise in Schuld verstrickt.
Martin Schulz zu „Unsere Mütter, unsere Väter“Was die Geschichte dieses Films uns lehrt
Sie werden zu Tätern, weil sie Dinge tun, die man nicht tun hätte müssen. Nur deshalb konnten Schoa und Krieg geschehen, weil Hunderttausende so oder anders mitgemacht haben, ohne dass sie selbst zu den Architekten der Zerstörung gehörten. Für uns Nachgeborene bleibt immer die belastende Frage, wie wir uns in vergleichbaren Situationen verhalten hätten. Zugleich sind diese Täter aber auch Opfer, die um ihr Überleben kämpfen und dabei in immer ausweglosere Situationen geraten, weil ihnen die Entschlossenheit zum Aufbegehren gegen die Unmenschlichkeit fehlt - und in den meisten Fällen auch die Möglichkeit hierzu.
Das ist das Aufwühlende an dem Film. Denn die jungen Menschen sind so normal und manchmal schrecklich unbedarft. Sie sind uns so nah in ihren Hoffnungen und Wünschen nach Liebe, Anerkennung und einem guten Leben. Der Film nähert sich der Frage „Wie war es möglich?“, indem er die subjektive Perspektive der Protagonisten einnimmt. Und gibt vielleicht gerade dadurch eine Antwort, wie es kein Geschichtsbuch je könnte.
 © SABINE ENGELS
© SABINE ENGELS![]() Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments
Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments
Auf unserem Kontinent wurden nach dem Krieg mit der europäischen Zusammenarbeit die richtigen Konsequenzen gezogen. Wir haben die Strukturen verändert, aber die Menschen sind die gleichen geblieben. Die europäische Einigung in der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts zieht die Lehre aus den Fehlern der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts. Nicht Versailler Vertrag, sondern Schuman-Plan lautet die Kurzformel dafür. Denn obschon wir Deutsche die Welt mit den abscheulichsten Verbrechen überzogen hatten, entschlossen sich unsere Nachbarn, uns eine weitere Chance zu geben, unser Land nicht auf die Knie zu zwingen, sondern uns die Hand zu reichen.
Wie verständlich erscheint rückblickend der Wunsch nach der Zerstörung Deutschlands, angesichts des Grauens der Jahre 1933 bis 1945. Ich erinnere mich gut, wie ich als Austauschschüler nach Frankreich kam und es dort noch erhebliche Ressentiments gegen Deutsche in den französischen Gastfamilien gab - aber nach ein paar Wochen trennten wir uns als Freunde und bildeten damit einen kleinen, aber immerhin einen Mosaikstein für das europäische Einigungswerk.
- „Unsere Mütter, unsere Väter“ im ZDF: Die Geschichte deutscher Albträume
- Leserdebatte zu „Unsere Mütter, unsere Väter“: Die F.A.Z. bittet um Ihre Texte und Fotos
- Dieter Wellershoff sieht fern: „Ich war der richtige Soldat“
- Filmproduzent Nico Hofmann: Es ist nie vorbei
Jedoch, trotz aller Erfolge: Der Firnis der Zivilisation bleibt dünn. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde und die soziale Demokratie sind zivilisatorische Errungenschaften, die nicht zeitlos sind. In der Geschichte unseres Kontinents bilden sie eher die Ausnahme. In Westeuropa sind sie seit sechs Jahrzehnten verwirklicht - in Süd- und Osteuropa erst deutlich kürzer. Die Freiheit, die Demokratie, müssen jeden Tag aufs Neue erstritten werden.
Das geschieht nicht automatisch, ganz im Gegenteil, denn schon sind erste Risse in dem Firnis erkennbar: Das skandalöse Darstellen deutscher Politiker in NS-Uniformen in manchen ausländischen Boulevardzeitungen und auf den Plakaten zorniger Demonstranten, die auch gegen ein „Brüssel-Diktat“ anrennen; der arrogante Blick einiger in Deutschland auf die vermeintlich faulen Südländer, denen man „mal eine Lektion erteilen“ müsste, der verkennt, wie groß das Geschenk unserer Nachbarn war, als wir nach dem Zweiten Weltkrieg in die Völkerfamilie zurückkehren durften, und der übersieht, wie abhängig unser Land ökonomisch vom Miteinander in Europa ist; das Fordern einer „marktkonformen Demokratie“, die keine Parlamente und keine Bürgerbeteiligung mehr braucht, ja, sie als Standortnachteil abkanzelt; die Wiederentdeckung des „Anderen“, also die Renaissance des Trennenden, und nicht mehr die Suche nach dem Ausgleich - all das sind aktuelle Phänomene, die mir große Sorgen machen und die wir nicht unwidersprochen stehenlassen dürfen.
So ärgerlich vieles in Europa und an der europäischen Bürokratie ist, was dringend abgestellt werden muss: Dennoch bin ich dankbar, dass meine Generation ihren Kindern und Enkeln nicht mehr vom Krieg erzählen muss, so wie noch die Generation meiner Eltern. Deshalb kämpfe ich so vehement für das europäische Einigungswerk. Denn wenn wir die Strukturen zerstören, die die Dämonen von einst gebändigt haben, riskieren wir viel. Wir riskieren, zu Beginn des 21.Jahrhunderts die Fehler des frühen 20.Jahrhunderts zu wiederholen.
Der dritte und letzte Teil von „Unsere Mütter, unsere Väter“ läuft am Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF.
Martin Schulz (SPD), geboren 1955 im Landkreis Aachen, gelernter Buchhändler und ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Würselen, ist Präsident des Europäischen Parlaments. Als solcher hat er 2012 den Friedensnobelpreis für die Europäische Union entgegengenommen. Im Rowohlt Verlag ist kürzlich sein Buch „Der gefesselte Riese. Europas letzte Chance“ erschienen.
Quelle: F.A.Z.
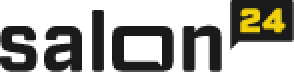








Komentarze
Pokaż komentarze (1)